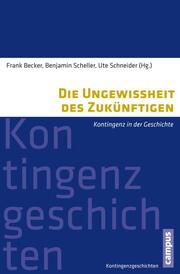Die Ungewissheit des Zukünftigen von Frank Becker/Benjamin Scheller/Ute Schneider
Die Ungewissheit des Zukünftigen
Kontingenz in der Geschichte, Kontingenzgeschichten 1
ISBN/EAN: 9783593505251
Sprache: Deutsch
Umfang: 262 S.
Einband: Paperback
Erschienen am
15.08.2016
Auf Wunschliste
Lange galt es als Tugend des Historikers, das vergangene Geschehen zu ordnen: Übersichtlichkeit zu schaffen, wo Durcheinander herrschte, kausale Zusammenhänge zu erkennen, wo das Vorher und Nachher chaotisch aufeinander folgten. Die aktuelle historische Forschung erschüttert diese Sichtweise mit dem Hinweis auf Beliebigkeit, Zufälligkeit und Ungewissheit - allesamt Bedeutungsschichten des Begriffs der Kontingenz. Kontingent erscheint historisches Geschehen dem rückblickenden Beobachter - und nicht weniger bereits den Zeitgenossen. Der Band behandelt Begegnungen mit Zukunftsungewissheit und bietet Reflexionen über den Begriff der Kontingenz, die aus Geschichtswissenschaft, Soziologie, Philosophie und Politikwissenschaft stammen.
Frank Becker ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen. Benjamin Scheller ist Professor für die Geschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit an der Universität Duisburg-Essen und Sprecher der DFG-Forschungsgruppe »Ambiguität und Unterscheidung. Ute Schneider ist Professorin für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Duisburg-Essen.
Vorwort Der vorliegende Band eröffnet die neue Reihe "Kontingenzgeschichten". Seine Beiträge gehen größtenteils auf Vorträge zurück, die ihre Autorinnen und Autoren bei verschiedenen Veranstaltungen des Graduiertenkollegs "Vorsorge, Voraussicht und Vorhersage. Kontingenzbewältigung durch Zukunftshandeln" in Essen gehalten haben. Sie thematisieren unterschiedliche Dimensionen der Geschichte und Konzeptualisierung von Kontingenz, die für das Forschungsprogramm des Kollegs von Bedeutung sind und auch über dieses hinausweisen. Dabei nehmen sie komplementäre, aber auch kontrastierende, historische, sozialwissenschaftliche und philosophische Perspektiven ein. Das Graduiertenkolleg "Vorsorge, Voraussicht und Vorhersage", das die Deutsche Forschungsgemeinschaft 2013 am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen eingerichtet hat, steht im Kontext einer ganzen Reihe von aktuellen Forschungsunternehmungen, die sich in unterschiedlicher Weise mit der Historizität von Zukunft und den ungewissen Möglichkeiten befassen, die diese stets barg und birgt. Dabei liegt sein spezifischer Zugang darin, die Analyse von der Ebene der Zukunftsvorstellungen auf die Ebene der aktiven Haltungen zu verlagern, welche die Akteure zur Zukunft einnahmen und auf die Handlungsoptionen, die diese aktiven Haltungen ermöglichten. Sie sollen kulturvergleichend und epochenübergreifend untersucht werden, um so die Pluralität gesellschaftlicher Möglichkeitshorizonte in der Geschichte herauszuarbeiten. In der Reihe "Kontingenzgeschichten" sollen künftig Beiträge und Arbeiten erscheinen, die sich diesem Forschungsprogramm verschreiben, unabhängig davon, ob sie im Kontext des Graduiertenkollegs "Vorsorge, Voraussicht und Vorhersage" entstanden sind. Wir danken Andreas Blume, Philipp Föhrenbach, Pamela Mannke-Gardecki, Franzisca Scheiner, Dr. Olav Heinemann und Dr. des. Christian Hoffarth für tatkräftige Hilfe bei der Redaktion des Bandes, dem Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und seinem Direktor Claus Leggewie für Gastfreundschaft und Unterstützung bei den Tagungen und Workshops des Graduiertenkollegs, Jürgen Hotz vom Campus Verlag für die gute Zusammenarbeit und nicht zuletzt der Deutschen Forschungs-gemeinschaft für die Bezuschussung der Druckkosten. Frank Becker, Benjamin Scheller und Ute Schneider Essen im Mai 2016 Kontingenzkulturen - Kontingenzgeschichten: Zur Einleitung Benjamin Scheller Kontingenz hat ihre Geschichten. Denn Menschen sahen und sehen sich stets durch die Möglichkeiten, die die Zukunft birgt, herausgefordert. Wie sie sich mit diesen auseinandersetzten und sich auf sie einstellten, ist dabei jedoch abhängig von unterschiedlichen Praxisfeldern und variiert historisch. Das ist im Kern die Arbeitshypothese des Graduiertenkollegs 1919 Vorsorge, Voraussicht und Vorhersage, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Jahr 2013 am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen eingerichtet hat. Es hinterfragt mit dieser Hypothese eine historische Meistererzählung, die zum einen fest in den Geschichts- und Kulturwissenschaften verankert ist, zum anderen jedoch geradezu zum Selbstverständnis der westlichen Moderne gehört: Die Erzählung von der Entdeckung der Kontingenz und ihrer aktiven Bewältigung in der Moderne. Diese Erzählung besteht aus drei Teilnarrativen. Das Erste hat die Germanistin Susanne Reichlin unlängst mit den Worten resümiert: "Während in der Vormoderne Kontingenz bloß eine vordergründige Instabilität darstellt, die durch eine höhere zeitlose Ordnung stabilisiert ist, wird in der Moderne die Ordnung selbst kontingent." Die historische Voraussetzung für diese Entgrenzung des Möglichkeits-bewusstseins wird zweitens in seiner Freisetzung aus den Bindungen an bisherige Erfahrungen gesehen, also in jenem Prozess, den Reinhart Koselleck als das Auseinandertreten von "Erfahrungsraum und Erwartungshorizont" charakterisiert und auf die Neuzeit, vor allem aber auf die von ihm sogenannte Sattelzeit der hundert Jahre zwischen 1750 und 1850, datiert hat. Mit Koselleck wird dieses Auseinandertreten einerseits als eine Folge der Erfahrung beschleunigten gesellschaftlichen und technologischen Wandels seit der Industrialisierung gesehen. Gleichzeitig habe es sich um einen Prozess der Säkularisierung gehandelt, da im Rahmen des eschatologisch geschlossenen religiösen Weltbildes des Mittelalters und der frühen Neuzeit eine offene Zukunft im Wortsinne undenkbar gewesen sei. Und diese neue Zeiterfahrung und Zukunftskonzeption sei drittens wiederum die Voraussetzung dafür gewesen, dass sich auch die Haltung der Akteure gegenüber kontingenten Geschehnissen grundlegend gewandelt habe: Sie begannen nun zu kalkulieren und die Ungewissheit des Künftigen für ihre Zwecke zu nutzen. Während kontingente Ereignisse in der Vormoderne passiv erlitten worden seien, weil diese einer höheren, dem Menschen unergründlichen Ordnung folgten, würde Kontingenz, seit Beginn der Neuzeit beziehungsweise der Moderne, aktiv bewältigt. Praktiken der Kontingenzbewältigung wie Versicherungen oder verschiedene Formen der Prävention müssten daher als typisch modern betrachtet werden. Gegen dieses Konstrukt, das geradezu paradigmatischen Charakter hat, lässt sich allerdings eine Reihe von Einwänden formulieren. Zunächst einmal sind Praktiken, mit denen Akteure sich auf das künftig Mögliche einzustellen und/oder dieses als Chance zu nutzen versuchen, keineswegs ein Proprium der westlichen Moderne, sondern zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen belegt. Die Schadenversicherung auf Prämienbasis etwa ist eine Erfindung des späten Mittelalters. Praktiken der Prävention gegenüber extremen Naturereignissen haben eine lange Geschichte. Weitere Beispiele ließen sich anfügen. Selbstverständlich wurde Kontingenz in der Vormoderne auch religiös oder in anderer Weise außerweltlich bewältigt. Doch waren solche Deutungen wesentlich weniger hegemonial als vielfach behauptet. Als etwa die Stadt Florenz Anfang November 1333 eine Flutkatastrophe erlitt, sahen Prediger die Ursache des Katastrophengeschehens in den Sünden der Florentiner. Die sogenannten filosofi in natura und astrologi naturali - bei ihnen handelte es sich wahrscheinlich um Experten, die an einer Universität die Artes studiert hatten, erklärten die Flut mit einer fatalen Planetenkonstellation. Der kleine Rat der Stadt dagegen führte die Überschwemmung der Stadt auf die ungünstigen Positionen von Wehren und Wassermühlen zurück, die die Fluten des Arno gestaut hätten. Er verbot daher die Errichtung und Unterhaltung von Wehren und Wassermühlen für einen neuralgischen Flussabschnitt, um so künftigen Hochwasserkatastrophen vorzubeugen. Offensichtlich konnten in einer spätmittealter-lichen Stadtgesellschaft also transzendente und pragmatisch innerweltliche Perspektiven auf kontingentes Geschehen koexistierten. Das Vorhanden-sein ersterer machte letztere und die auf ihr basierenden Präven-tionsmaßnahmen keineswegs undenkbar. Vormoderne Ordnungsentwürfe beschränkten den Handlungsspielraum des Einzelnen also keinesfalls auf das passive Erleiden von künftigem, kontingentem Geschehen. Bereits Boethius, und damit der Begründer der nachantiken philosophischen Reflexion über Kontingenz, hatte in seiner Consolatio Philosophiae eine Argumentation entwickelt, die an der Auffassung einer göttlichen Vorsehung festhielt und dennoch dem Menschen die Fähigkeit zuschrieb, "seine zukünftigen Handlungen zu wählen und dadurch sein Schicksal selbst zu bestimmen". Auch dort, wo eine göttliche Ordnung und umfassendes göttliches Wissen als unumstößlich galten, konnte dem Menschen also das Vermögen attestiert werden, aktiv seine Zukunft zu gestalten. Vor allem aber beruht die Meistererzählung von der Moderne als Kontingenzkultur auf einem homogenisierenden Verständnis von Kultur, das diese einem Kollektiv von Akteuren, einer Epoche oder einem Raum als Ganzem zuordnet, welchen dann wiederum andere Kollektive, E...