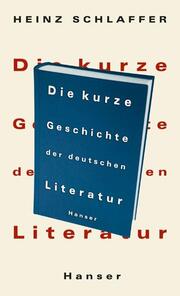Die kurze Geschichte der deutschen Literatur von Heinz Schlaffer
Die kurze Geschichte der deutschen Literatur
ISBN/EAN: 9783446201491
Sprache: Deutsch
Einband: gebundenes Buch
Erschienen am
18.02.2002
Auf Wunschliste
Was ist an deutscher Literatur eigentlich "deutsch"? An dieser Frage orientiert sich diese scharf argumentierende, anschaulich formulierte Literaturgeschichte, von den Anfängen deutscher Dichtung bis zur Gegenwart. Das Buch meidet Terminologien, mit denen die heutige Literaturwissenschaft dem Laien das bessere Verständnis verwehrt und vermittelt gleichzeitig neue Einsichten in den inneren Zusammenhang der deutschen Literatur.
Heinz Schlaffer, 1939 in Böhmen geboren, lebt in Stuttgart, wo er bis 2004 Professor für Literaturwissenschaft war. Er verfasste zahlreiche Bücher, wissenschaftliche Aufsätze und Essays.
InhaltDeutsch 7 Mißglückte AnfängeDas verschollene Mittelalter 22 Die verspätete Neuzeit 35 Der geglückte Anfang: Das 18. JahrhundertPfarrersöhne, Musensöhne 54 Die neue Sprache 73 Die unsterbliche Poesie 93 Fortgang, Wiederkehr und EndeFortgang: Das 19. Jahrhundert 113 Wiederkehr und Ende: Das 20. Jahrhundert 132 Geschichte der Literatur 153Geschichte der LiteraturLiterarische Werke unterliegen, je mehr Zeit seit ihrer Entstehung vergangen ist, einer desto strengeren Auswahl. Zunächst entscheiden sich die zeitgenössischen Leser für das offenbar Zeitgemäße unter den Neuerscheinungen, dann die späteren Leser für die erinnernswerten unter den einst erschienenen Büchern. Literaturhistoriker sind die spätesten Leser, die einem nachgeborenen Publikum vergegenwärtigen, was von früheren Werken noch lesenswert sei. In diesem zeitlich gestaffelten Auswahlverfahren werden die Kriterien nicht nur strenger, sondern auch anders, so daß sich die Nachwelt oft gerade jener Werke erinnert, die die Mitwelt übersah. Über das, was Gegenstand einer Literaturgeschichte ist, entscheidet also nicht die Mitwelt, sondern die Nachwelt, nicht die Zeit, sondern das Gedächtnis. Was eine Literaturgeschichte beachtet oder nicht beachtet, hängt davon ab, wie sie es bewertet (auch wenn sie sich dieser Voraussetzung gar nicht bewußt ist). Die Bewertung wiederum kann sich nur auf ein ästhetisches Urteil berufen: auf das künstlerische Niveau der Werke, wie es sich später kompetenten, d.h. im Umgang mit der Literatur verschiedener Epochen erfahrenen Lesern zeigt. Literaturgeschichten können also nicht allein, nicht einmal in der Hauptsache allein aus der Analyse des historischen Materials hervorgehen, da die Epoche nicht das letzte Wort über den Wert ihrer Werke haben darf. Ob Literaturgeschichten einer altmodischen biographischen, einer herkömmlichen ideengeschichtlichen oder modernen sozial- und funktionsgeschichtlichen Methode folgen - sie bleiben alle einem positivistischen Mißverständnis verhaftet, wenn sie die Wiedergabe der historisch vorgegebenen Strukturen zu ihrem Grund und Ziel erklären. Literaturgeschichten verschweigen ihre Abhängigkeit von ästhetischen Urteilen und vom Kanon der Nachwelt, weil sie die Entscheidungen, die zu diesem Kanon geführt haben, für subjektiv, für ideologisch bedingt, also für unwissenschaftlich halten. Die Beschreibung historischer Prozesse dagegen gilt als wissenschaftlich lösbare Aufgabe; daher beschränkt man sich bei der theoretischen Begründung der Literaturgeschichte auf eine historische Aufgabe, während man in der Praxis uneingestanden dem ästhetischen Kanon folgt. Der ästhetische Maßstab ist also faktisch wirksam, bleibt aber methodisch ungeklärt. Der eigentliche Aufbewahrungsort der Literatur ist nicht die vergangene Geschichte, sondern die gegenwärtige Bibliothek.[...]Ein Prinzip, das allen Literaturgeschichten zugrunde liegt, das sie sich aber selten bewußt machen, hat diese Kurze Geschichte der deutschen Literatur geleitet: die Unterscheidung des Geglückten vom Mißglückten. Eine solche Unterscheidung ist die elementare Aufgabe der Kritik, von den alexandrinischen Philologen, die den bis heute gültigen Kanon der griechischen Epen, Dramen und Gedichte zusammengestellt haben, bis zu den Mitgliedern heutiger Jurys, die Literaturpreise vergeben. In der Bibliothek von Alexandrien, aber auch bei Rezensionen in Tageszeitungen sind dieser kritischen, d.h. wörtlich "unterscheidenden", Tätigkeit einzelne Werke unterworfen. Sie dehnt sich jedoch auf ganze Epochen aus, sobald deutlich wird, daß ausgezeichnete Schriftsteller zu bestimmten Zeiten gehäuft auftreten. "Goldene Zeitalter" der Literatur fielen bereits Griechen und Römern auf; eine "silberne Latinität" w ...