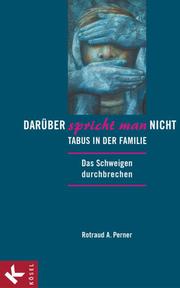Darüber spricht man nicht von Rotraud A Perner
Darüber spricht man nicht
Tabus in der Familie - Das Schweigen durchbrechen
ISBN/EAN: 9783466308415
Sprache: Deutsch
Umfang: 255 S.
Einband: kartoniertes Buch
Erschienen am
22.09.2008
Auf Wunschliste
Aus aktuellem Anlass: Das Schweigen durchbrechen Schweigen kann fatal sein. Immer wieder erreichen uns neue Schreckensnachrichten, die zeigen, wie die Überforderung in der Familie eskaliert: Missbrauch, Unterwerfung, Angstmache, ja Mord können Folgen familiärer Tabus sein. Dieses aufregende Buch zeigt, dass es Wege gibt, die Schweigespirale aus Halbwahrheiten, Missverständnissen und Tabus zu durchbrechen.
Rotraud A. Perner, geboren 1944, Psychotherapeutin / Psychoanalytikerin und promovierte Juristin, ist Universitätsprofessorin für Prävention an der Donau Universität Krems und Leiterin des Institut für Stressprophylaxe & Salutogenese (ISS) mit integrierter Praxis wie auch der angeschlossenen Akademie für Salutogenese & Mesoziation(R) (ASM) in Matzen bei Wien. Einer breiten Öffentlichkeit ist sie als Autorin zahlreicher Bücher zu Sexualität, Gewalt und Prävention sowie als vielgefragte Expertin in Funk und Fernsehen bekannt.
Als ich 1999 mein Buch zu den Schweigegeboten, Redetabus und Tabubrüchen in Familien erstmals veröffentlichte, stand ich noch voll unter dem Eindruck der Enttarnung des Briefbombenattentäters Franz Fuchs, der jahrelang, von seinen Ersparnissen lebend, im elterlichen Anwesen seine Höllenmaschinen konstruierte, ohne dass seine Eltern etwas ahnten - aber auch nicht nachfragten, was der einsame Bastler in seinem Zimmer so mache. Denn: Ich kannte aus meiner langjährigen psychotherapeutischen Tätigkeit so viele ähnlich verschlossene Männer, die beispielsweise ihren Ehefrauen manchmal sogar unter massiven Drohungen verbaten, bestimmte Räume zu betreten - so wie Ritter Blaubart im Märchen von Charles Perrault. Solche Bastelexperten waren dabei in der Minderzahl. Die meisten dieser scheinbaren Eremiten wollten sich nur ungestört in Frauenkleidern oder exotischeren Outfits vor Spiegel oder Kamera produzieren, andere wiederum im Internet nach Pornoseiten jagen. Konflikte mit ihren misstrauischen Ehefrauen galten nicht nur dieser Abschottung, sondern mangelnder Kommunikation, vor allem fehlender einfühlsamer Gespräche oder überhaupt wertschätzender Gemeinsamkeit. Nach der Selbstbefreiung des acht Jahre im Keller eingesperrten Entführungsopfers Natascha Kampusch und dem offensichtlichen Megadelikt von Amstetten - Inzest und Freiheitsberaubung, auch an dreien der sieben aus dieser verbrecherischen Beziehung stammenden Kinder, vermutet wird sogar die Ermordung eines Kindes unmittelbar nach dessen Geburt - tauchte medial das Stereotyp vom dämonischen Ingenieur auf, der wie die Bösewichte in James-Bond- oder Batman-Filmen unterirdische Verliese baut, nur eben in Schmalspurformat, von denen niemand etwas ahnt. Aber ahnt wirklich niemand etwas? Nicht Polizei und Jugendamt, nicht die Besucher, nicht Nachbarn, vor allem nicht Ehefrauen oder Mütter? Ist es Angst oder Abwehr, die den Allernächsten die Augen verschließt - oder haben sie kein anderes Verhaltensmodell als Wegschauen? Hinschauen wird dafür zum Sport »rasender Reporter«. Die Bandbreite reicht dabei vom »einfühlsamen Interview« im Fernsehen (mit anschließender internationaler Vermarktung) bis zur Hetzjagd auf Klinikfotos der Belasteten aus Baumkronen oder gar von Hubschraubern aus, allenfalls noch Phantomzeichnungen: »So könnte. heute aussehen«. Da ich damals bei der Erstverfassung dieser Abhandlung bereits selbst über langjährige Erfahrung als Medienarbeiterin verfügte, kannte ich auch die Spielregeln »hinter den Kulissen« - vor allem die Jagd nach O-Tönen und Betroffenen, die bereit sind, vor laufender Kamera ihr Herz zu öffnen - mit oder ohne Honorar. Und ich wusste, wie viele davon nur durch die spezifische Aufmerksamkeit der professionellen GesprächspartnerInnen zum Reden motiviert sind - wie in Beratung oder Therapie ja auch -, daheim aber wieder in dumpfes Schweigen verfallen. Ich selbst hatte in der Zusammenarbeit mit Medien einige »Damaskus-Erlebnisse«: Ursprünglich durchaus bereit, Kontakte zwischen Exklientinnen und Journalisten herzustellen, wenn ich der Meinung war, dass dies deren »Reinigungsprozess« dienlich wäre, änderte ich bald diese Einschätzung. Anlass dazu gab eine junge Frau, Klientin in der Sexualberatungsstelle, die ich Ende der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts mit Kollegen gemeinsam gegründet hatte, und deren traumatische Belastungsstörung nach jahrelangem sexuellem Missbrauch gut überwunden war. Als ein junger Journalist für eine zweiteilige Serie zu diesem - damals in seiner Allgegenwart noch kaum im Bewusstsein der Bevölkerung präsenten - Delikt in einem seriösen Wochenmagazin eine »Betroffene« suchte, stellte ich den Kontakt her. Die beiden in etwa Gleichaltrigen verstanden sich gut und die junge Frau füllte zwei Tonbänder mit dem Ausdruck ihres Leids. Tatsächlich war dies für sie hilfreich -und auch der Artikel gab ihr Selbstbewusstsein. Dann aber traf sie sich nochmals mit dem jungen Mann, eben aus der entstandenen Sympathie, und der erzählte ihr voll